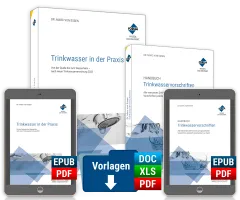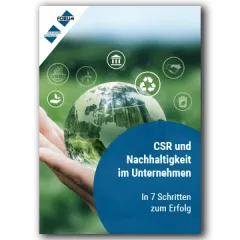Primärenergiefaktor und Primärenergiebedarf: die Schlüssel zur energieeffizienten Gebäudeplanung
20.03.2025 | S.Horsch – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Steigende Energiekosten und verschärfte Klimaziele steigern die Bedeutung der Bewertung energetischer Gesamtsysteme. Der Primärenergiefaktor (PEF) quantifiziert als Schlüsselkennzahl den Ressourcenaufwand von der Energiegewinnung bis zur Nutzung. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch der Primärenergiebedarf, da er den gesamten Energieeinsatz beschreibt, der für den Betrieb eines Gebäudes benötigt wird. Die Integration in das Gebäudeenergiegesetz (GEG) unterstreicht die politische Relevanz für nachhaltiges Bauen. Wie berechnet man den Primärenergiefaktor? Und wie beeinflusst der Faktor die Gebäudekosten?
Inhaltsverzeichnis:
- Was ist der Primärenergiefaktor und warum ist er wichtig?
- Berechnung des Primärenergiebedarfs: Formel und praktische Anwendung
- Primärenergiefaktoren Tabelle verschiedener Energieträger im Vergleich
- Bedeutung des Primärenergiefaktors für die Gebäudeplanung
- Einfluss auf den Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes
- Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Primärenergiefaktor
- Fazit: Der Primärenergiefaktor als zentrales Instrument für nachhaltiges Bauen
Der Primärenergiefaktor (PEF) und der daraus resultierende Primärenergiebedarf sind wichtige Kennzahlen zur energetischen Bewertung von Gebäuden und Energiesystemen. Sie ermöglichen eine umfassende Analyse des Energieeinsatzes entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Gewinnung über die Umwandlung bis hin zur Nutzung. Diese Faktoren sind von zentraler Bedeutung für eine nachhaltige und ressourcenschonende Gebäudeplanung. Angesichts steigender Energiekosten und eines zunehmenden Umweltbewusstseins gewinnen sie für Fachplaner in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik immer mehr an Relevanz.
Was ist der Primärenergiefaktor und warum ist er wichtig?
Der Primärenergiefaktor beschreibt das Verhältnis zwischen eingesetzter Primärenergie und der tatsächlich beim Verbraucher ankommenden Endenergie. Er berücksichtigt sämtliche Energieverluste, die entlang der Prozesskette entstehen – von der Rohstoffgewinnung über die Umwandlung bis hin zum Transport und der Speicherung eines Energieträgers.
→ Ein niedriger Primärenergiefaktor deutet auf eine hohe Effizienz bei der Energiebereitstellung hin, während ein hoher Wert erhebliche Verluste oder einen hohen Energieaufwand signalisiert. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die Beurteilung verschiedener Heizsysteme und Energieträger im Kontext der Gebäudeenergieeffizienz.
Zur Ermittlung des Jahresprimärenergiebedarfs für Wohn- und Nichtwohngebäude nach den §§ 20 und 21 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind für den nicht erneuerbaren Anteil die unten genannten Primärenergiefaktoren der Anlage 4 zu verwenden. In § 22 finden sich viele Ausnahmetatbestände, die meist als „Kann“-Formulierungen nicht verpflichtend sind.
Der Primärenergiebedarf beschreibt zusätzlich zum Energiegehalt eines Brennstoffs oder Energieträgers die Energiemenge, die durch vorgelagerte Prozesse bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung benötigt wird. Bei der Betrachtung von Gebäuden enthält die Primärenergie gegenüber der Endenergie die zusätzliche Energie von Prozessen außerhalb der Gebäudegrenze.
Berechnung des Primärenergiebedarfs: Formel und praktische Anwendung
Zur Berechnung des Primärenergiebedarfs für Wohn- und Nichtwohngebäude nach den §§ 20 und 21 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wird der Endenergiebedarf abhängig vom Brennstoff mit dem jeweiligen Primärenergiefaktor multipliziert. Das GEG gibt die zu verwendenden Primärenergiefaktoren vor.
In der Praxis wird der Primärenergiebedarf in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben. Diese Kennzahl ist ein zentraler Indikator für die energetische Gesamtbewertung eines Gebäudes und spielt eine wichtige Rolle bei der Erstellung von Energieausweisen sowie bei der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
Formel zur Berechnung des Primärenergiebedarfs:
Primärenergiebedarf = Endenergiebedarf × Primärenergiefaktor
Während der Endenergiebedarf die tatsächlich im Gebäude benötigte Energie widerspiegelt, umfasst der Primärenergiebedarf den gesamten Energieaufwand inklusive aller Verluste entlang der Versorgungskette.
Primärenergiefaktoren Tabelle verschiedener Energieträger im Vergleich
Die Primärenergiefaktoren variieren je nach Energieträger erheblich. Eine Übersicht über gängige Werte zeigt, welche Faktoren zur Berechnung des Primärenergiebedarfs herangezogen werden können:
| Nummer | Kategorie | Energieträger | Primärenergiefaktoren nicht erneuerbarer Anteil |
| 1 | Fossile Brennstoffe | Heizöl | 1,1 |
| 2 | Erdgas | 1,1 | |
| 3 | Flüssiggas | 1,1 | |
| 4 | Steinkohle | 1,1 | |
| 5 | Braunkohle | 1,2 | |
| 6 | Biogene Brennstoffe | Biogas | 1,1 |
| 7 | Bioöl | 1,1 | |
| 8 | Holz | 0,2 | |
| 9 | Strom | netzbezogen | 1,8 |
| 10 | gebäudenah erzeugt (aus Photovoltaik oder Windkraft) | 0,0 | |
| 11 | Verdrängungsstrommix für KWK | 2,8 | |
| 12 | Wärme, Kälte | Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 0,0 |
| 13 | Erdkälte, Umgebungskälte | 0,0 | |
| 14 | Abwärme | 0,0 | |
| 15 | Wärme aus KWK, gebäudeintegriert oder gebäudenah | nach Verfahren B gemäß DIN V 18599-9: 2018-09 Abschnitt 5.2.5 oder DIN V 18599-9: 2018-09 Abschnitt 5.3.5.1 | |
| 16 | Siedlungsabfälle | 0,0 | |
Quelle: Anlage 4 GEG 2024
Diese Werte verdeutlichen, dass erneuerbare Energien sowie effiziente Fernwärmesysteme aus primärenergetischer Sicht besonders vorteilhaft sind. Der vergleichsweise hohe Faktor für Netzstrom zeigt die erheblichen Verluste, die bei der Stromerzeugung und -verteilung auftreten.
Produktempfehlung:
Die Bestimmung des Primärenergiebedarfs und die Berücksichtigung des Primärenergiefaktors sind komplexe, aber entscheidende Schritte für eine energieeffiziente Gebäudeplanung.
Um diese Herausforderungen effizient zu meistern, bietet die Software „Gebäudebewertung direkt“ eine umfassende Lösung für die präzise Analyse und Optimierung von Gebäuden. Probieren Sie's gleich mal aus und bestellen Sie hier!
Was ist ein guter Primärenergiefaktor?
Ein guter Primärenergiefaktor ist ein niedriger Wert, der eine umweltschonende und effiziente Energieform repräsentiert. Je niedriger der Primärenergiefaktor, desto besser ist die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des Energieträgers.
Einige Beispiele für gute Primärenergiefaktoren sind:
- Erneuerbare Energien: Häufig haben sie einen Faktor von 0, was optimal ist.
- Holz: Mit einem Primärenergiefaktor von 0,2 ist es sehr günstig.
- Umweltenergie (Solarenergie, Umgebungswärme): Hat einen Primärenergiefaktor von 0.
- Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung: Kann einen Faktor von 0 bis 0,7 haben, abhängig von der Effizienz.
Im Vergleich dazu haben fossile Brennstoffe wie Erdgas und Heizöl einen höheren Primärenergiefaktor von 1,1, während Strom mit 1,8 den höchsten Wert aufweist.
Bedeutung des Primärenergiefaktors für die Gebäudeplanung
Ein niedriger Primärenergiefaktor wirkt sich positiv auf die Energiebilanz eines Gebäudes aus. Besonders Fernwärmesysteme und Wärmepumpen erweisen sich als vorteilhafte Lösungen. Moderne Wärmepumpen erreichen eine Jahresarbeitszahl von über 1,63, wodurch sie primärenergetisch effizienter sind als Direktstromheizungen.
Für Fachplaner in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik ist die sorgfältige Auswahl der Energieträger essenziell. Neben dem Primärenergiefaktor müssen auch Aspekte wie Investitionskosten, Wartungsaufwand und die lokale Verfügbarkeit der Energiequellen berücksichtigt werden.
Einfluss auf den Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes
Der Primärenergiebedarf eines Gebäudes setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, darunter:
- Heizenergiebedarf
- Warmwasserbereitung
- Kühlung und Klimatisierung
- Beleuchtung
- Hilfsenergie für Pumpen und Regelung
Durch eine gezielte Optimierung jedes einzelnen Bereichs sowie den Einsatz effizienter Energieträger kann der Gesamtenergiebedarf erheblich gesenkt werden. Dies führt nicht nur zu niedrigeren Betriebskosten, sondern auch zu einer deutlichen Reduktion der CO₂-Emissionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Primärenergiefaktor
1. Warum ist der Primärenergiefaktor wichtig? Der Primärenergiefaktor ermöglicht eine realistische Bewertung der gesamten Energieeffizienz eines Gebäudes und hilft bei der Auswahl nachhaltiger Energieträger. Für Planer in der Gebäudetechnik ist das fundierte Wissen über Primärenergiefaktoren unerlässlich. Es ermöglicht ihnen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen von Bauherren entsprechen und gleichzeitig die gesetzlichen sowie ökologischen Vorgaben erfüllen
2. Welcher Energieträger hat den besten Primärenergiefaktor? Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie haben einen Primärenergiefaktor von 0,0, da sie keine fossilen Ressourcen verbrauchen.
3. Wie beeinflusst der Primärenergiefaktor die Gebäudekosten? Ein niedriger Primärenergiefaktor senkt langfristig die Betriebskosten durch geringeren Energieverbrauch und bessere Fördermöglichkeiten.
4. Ist der Primärenergiefaktor gesetzlich vorgeschrieben? Ja, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gibt Höchstwerte für den Primärenergiebedarf vor, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu gewährleisten.
5. Kann der Primärenergiefaktor über die Jahre variieren? Ja, durch technologische Fortschritte und Änderungen in der Energiegewinnung können sich die Faktoren im Laufe der Zeit verändern.
6. Welche Rolle spielt der Primärenergiefaktor bei Förderprogrammen? Viele staatliche Förderprogramme setzen niedrige Primärenergiefaktoren als Voraussetzung für Zuschüsse oder vergünstigte Kredite.
Produktempfehlung:
Der Primärenergiefaktor ist ein entscheidender Parameter bei der Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und spielt eine zentrale Rolle bei der Einhaltung der Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Um die komplexen Berechnungen und Nachweise in der Praxis sicher umzusetzen, bietet das Praxishandbuch „Planung und Ausführung nach GEG“ eine fundierte und anwendungsorientierte Unterstützung.
Fazit: Der Primärenergiefaktor als zentrales Instrument für nachhaltiges Bauen
Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Energie- und Gebäudetechnologien macht eine regelmäßige Neubewertung der Primärenergiefaktoren notwendig. Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung und eine fortlaufende Optimierung der Energieversorgung können Gebäude langfristig nachhaltig und energieeffizient geplant werden.
Die Berücksichtigung des Primärenergiefaktors ist ein entscheidender Schritt in Richtung klimafreundlicher Bauweisen, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile bieten. Fachplaner und Bauherren sollten daher stets auf dem neuesten Stand bleiben, um die besten Lösungen für energieeffiziente Gebäude zu realisieren.
Quellen: „Planung und Ausführung nach GEG“, 2025, FORUM VERLAG HERKERT GMBH;