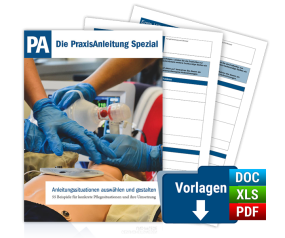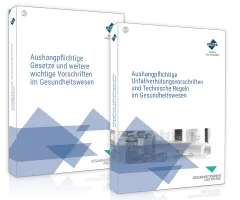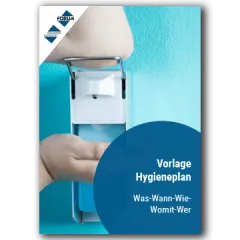Wie funktioniert Pneumonieprophylaxe? – Definition, Maßnahmen und Übungen
11.02.2025 | T. Reddel – Online-Redaktion, FORUM VERLAG HERKERT GMBH
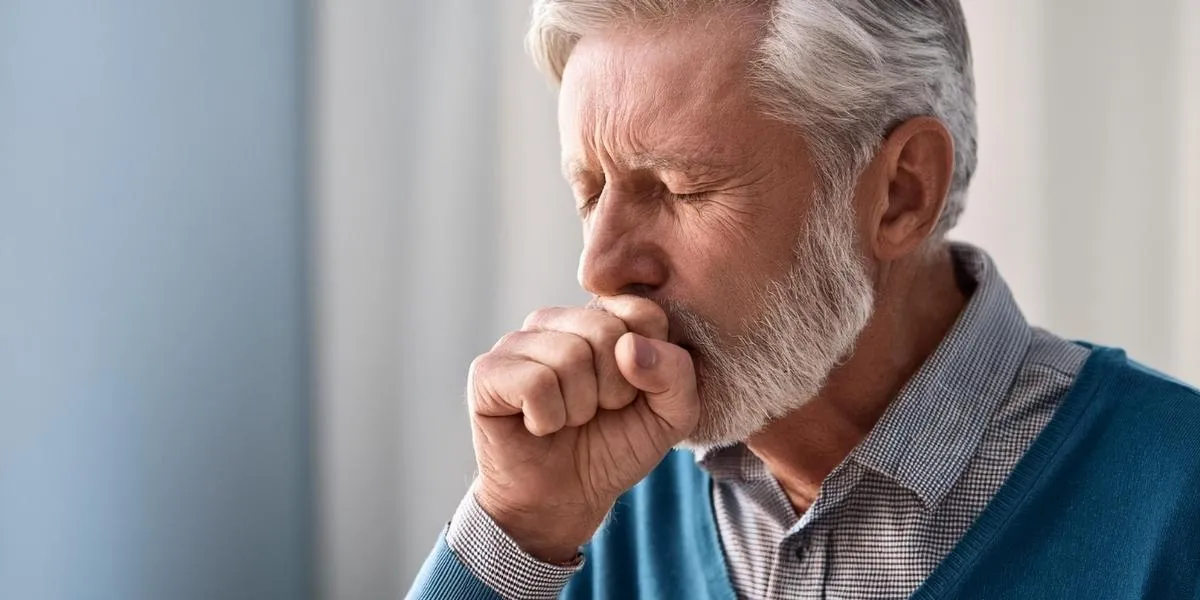
Nach Angaben des Forschungszentrums „Helmholtz Zentrum München“ ist die Pneumonie die häufigste tödliche Infektionskrankheit in Westeuropa. Umso wichtiger ist es, dass Pflegekräfte und andere Verantwortliche geeignete Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe kennen. Wir geben einen Überblick über Symptome, Risikofaktoren und Übungen.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Pneumonieprophylaxe?
- Was sind typische Symptome einer Pneumonie?
- Risikofaktoren bei Pneumonieprophylaxe
- Welche Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe gibt es?
- Anleitungen zur Pneumonieprophylaxe
Was ist Pneumonieprophylaxe?
Die Pneumonieprophylaxe umfasst alle pflegerischen Maßnahmen, die das Auftreten einer Lungenentzündung (Pneumonie) verhindern sollen. Bei einer solchen Entzündung werden die Lungenbläschen oder das Lungengewebe geschädigt, was zu schweren Komplikationen bis hin zum Tod führen kann.
In der Medizin werden verschiedene Arten der Pneumonie unterschieden:
- Primär- und Sekundärpneumonie
- Infektiöse und nichtinfektiöse Pneumonie
- Lobärpneumonie
- Bronchopneumonie
- Interstitielle Pneumonie
- Pleuropneumonie
- Nosokomiale Pneumonie
Je nach Art der Lungenentzündung kommen unterschiedliche Ursachen infrage. Sie sind meist infektiöser, allergischer oder physikalisch-chemischer Natur.
Um solche Komplikationen zu vermeiden, führen Pflegekräfte bestimmte prophylaktische Maßnahmen und Übungen durch. Damit lassen sich gleich mehrere Ziele erreichen, die den Pflegeprozess erleichtern.
Ziele der Pneumonieprophylaxe
Die Pneumonieprophylaxe dient in erster Linie dem Vermeiden einer Lungenentzündung. Dazu gehören einige Teilziele, die häufig im sogenannten LISA-Prinzip definiert werden.
Dieses Konzept formuliert folgende Teilziele:
| L | Lungenbelüftung verbessern (Mobilisation, Atemübungen und Lagerungstechniken) |
| I | Infektionen vermeiden (Mund- und Nasenpflege, aseptisches Arbeiten, keine Keimübertragungen) |
| S | Sekretmanagement fördern (Verflüssigung, Mobilisierung und Entleerung von Bronchialsekreten) |
| A | Aspiration vermeiden (Oberkörperhochlagerung während/nach Mahlzeiten, Schlucktraining) |
Darüber hinaus soll die Pneumonieprophylaxe mögliche Schmerzen beim Atmen verhindern und Ängsten vorbeugen. Doch woran erkennen Pflegekräfte eine Lungenentzündung?
Was sind typische Symptome einer Pneumonie?
Personen mit einer typischen Pneumonie entwickeln meist innerhalb von 12 bis 24 Stunden folgende Symptome:
- Hohes Fieber
- Schüttelfrost
- Erschöpfung
- Appetitlosigkeit
- Husten (oft mit Übelkeit und Erbrechen, Abhusten)
- Auftreten von Sputum (eitrig, grün und/oder gelblich gefärbt)
- Atemnot/Kurzatmigkeit
- Schmerzen, insbesondere beim Atmen
- Schonatmung und/oder Nasenflügelatmung
- Rasselgeräusche beim Atmen
Bei atypischen Lungenentzündungen treten die Symptome meist langsamer auf, sind nicht immer eindeutig zuzuordnen und schränken die Betroffenen nicht so stark ein. Häufige Anzeichen sind hier trockener Husten und Fieber unter 39 °C. Nicht selten werden die Symptome als grippaler Infekt oder andere Erkrankung fehldiagnostiziert.
Umso wichtiger ist es, die möglichen Risikofaktoren einer Pneumonie zu kennen, bevor solche Symptome auftreten.
Risikofaktoren bei Pneumonieprophylaxe
Vor allem bei pflegebedürftigen Personen können bestimmte Risikofaktoren vorliegen, die das Auftreten einer Pneumonie ermöglichen.
Hierzu gehören unter anderem folgende Vorerkrankungen oder Merkmale:
- Hohes Alter und mehrere akute Erkrankungen
- Unzureichender Allgemein- oder Ernährungszustand
- Herz- oder Lungenerkrankungen
- Kontakt mit/Einatmen von gesundheitsschädigenden Substanzen
- Immunschwäche (etwa durch Infektionen, Medikamente, Bestrahlung, Chemotherapie)
- Immunsuppressive Therapie
- Immobilität
- (Künstliche) Beatmung
- Schonatmung (etwa nach Operationen)
- Bewusstlosigkeit
- Rauchen
Diese Faktoren können das Risiko einer Lungenentzündung erhöhen. Daher ist es wichtig, geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen.
Welche Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe gibt es?
Grundsätzlich helfen sowohl Atemübungen als auch Übungen zur Mobilisation und eine atemunterstützende Lagerung der Betroffenen. Denn verringerte Beweglichkeit und einseitige Lagerung können das Risiko für Pneumonien erhöhen.
Daher werden im Folgenden zwei geeignete pflegerische Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe vorgestellt.
Atemübung: Gähnen
Die Gähnatmung soll die Atemmuskulatur dehnen und so die allgemeine Atemsituation der Betroffenen verbessern.
Sie wird wie folgt durchgeführt:
| 1. | Morgens nach der Begrüßung die pflegebedürftige Person motivieren/auffordern, kräftig zu gähnen. |
| 2. | Person soll laut den Buchstaben „A“ sagen, um mit dem Vokal einen natürlichen Gähnvorgang hervorzurufen. |
| 3. | Körper während des Gähnvorgangs so weit wie möglich strecken und dehnen (das Recken der Arme unterstützt den Gähnvorgang und führt zu einer stärkeren Weitung der Lunge). |
| 4. | Atmung beobachten und nach aktuellem Wohlbefinden fragen. |
| 5. | Beobachtungen und Informationen im Pflegebericht, Leistungsnachweis oder in anderen Unterlagen dokumentieren. |
Pflegekräfte können die Atmung durch geeignete Musik unterstützen, um ein Gähnen und tieferes Atmen zu provozieren. Hierzu motivieren sie die oder den Pflegebedürftigen, ein bestimmtes Lied mit Vokalbetonung mitzusingen, wie etwa „A, B, C – Die Katze liegt im Schnee“.
Falls gewünscht, können die Sing- und Summübungen nicht nur als individuelles Tagesangebot, sondern auch als Gruppenangebot durchgeführt werden.
Lagerung: Oberkörperhochlagerung
Lagerungen zur Pneumonieprophylaxe können die Belüftung der Lunge fördern, den Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege anregen und etwaiges Sekret in den Atemwegen lösen.
Die Oberkörperhochlagerung kann neben der Atmung insbesondere das Abhusten erleichtern. Sie eignet sich zur Bewältigung akuter Atemnot und als prophylaktische Maßnahme. Zur Vorsorge kann die Übung im Laufe des Tages immer wieder angeboten und durchgeführt werden. Wichtig ist eine ausreichende Händehygiene, da die Haut mit Sekreten in Kontakt kommen kann.
Bei der Oberkörperhochlagerung ist folgender Ablauf zu beachten:
| 1. | Pflegebedürftige Person auf den Rücken legen und oberes Bettteil je nach Möglichkeit per Hand oder elektronisch in die entsprechende Höhe bringen. |
| 2. | Arme rechts und links je auf ein Kissen in der Größe 80 x 80 cm oder 40 x 80 cm lagern. |
| 3. | Kissen im Knopfbereich nach innen stülpen („Schiffchenform“). |
| 4. | Falls keine Spastik vorliegt, kann gegebenenfalls ein Kissen im Fußbereich unterstützen. Dieses Kissen sollte aber nicht für längere Zeit dort belassen werden, um einen Dauerreiz an der Fußsohle zu vermeiden. |
| 5. | Falls Fersen besonders empfindlich sind, diese frei lagern. |
| 6. | Zwischen den Lagerungen und/oder nach Lagerung der Person beim Abhusten unterstützen. Hierfür die Person leicht anheben und seitlich drehen, um das Abhusten zu ermöglichen. |
| 7. | Bei Bedarf den Kopf halten und Papiertaschentücher reichen oder das Sekret abwischen. |
| 8. | Mundpflege oder Getränk anbieten. |
Auch Körperhaltungen wie der Kutschersitz helfen dabei, die Atmung zu erleichtern. Nähere Informationen hierzu finden Sie in unserem Glossar.
Wichtig: Bei allen pflegerischen Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe ist sicherzustellen, dass die betroffene Person keine Schmerzen empfindet. Denn Schmerzen verringern die Bereitschaft, an Atemübungen und anderen Maßnahmen teilzunehmen. Daher sollten die verantwortlichen Pflegekräfte auf alle verbalen und nonverbalen Äußerungen (Mimik, Gestik, Körperhaltung) achten.
Anleitungen zur Pneumonieprophylaxe
Anleitungen wie interne Pflegestandards und Checklisten helfen dabei, den fachlichen Umgang mit Pneumonien zu regeln und geeignete Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe festzulegen. Hierfür gibt es bereits fertige Lösungen.
Produktempfehlungen
Die Software „Pflege- und Expertenstandards auf CD-ROM“ liefert fertige Pflegestandards und zahlreiche Arbeitshilfen zur Pneumonieprophylaxe. Dazu gehören beispielsweise eine Einschätzungsskala zur Pneumoniegefährdung und Checklisten zur Sputumbeobachtung.
Da die Pneumonieprophylaxe bereits in der Pflegeausbildung eine wichtige Rolle spielt, sollten Praxisanleitungen bereits frühzeitig entsprechende Anleitungssituationen durchführen. Passende Hilfestellung liefert die Formularsammlung „Die PraxisAnleitung-Spezial - Anleitungssituationen auswählen und gestalten“. Sie enthält 55 Beispiele für konkrete Pflegesituationen und ihre Umsetzung.
Und für die Einarbeitung ausländischer Pflegekräfte gibt es die „Mehrsprachigen Pflegeanleitungen auf Knopfdruck“ mit fertigen Anleitungen in über 30 Sprachen. Jetzt informieren!
Quellen: „Pflege- und Expertenstandards auf CD-ROM“, „Sofort einsetzbare Pflegeanleitungen“